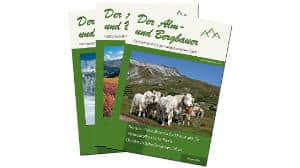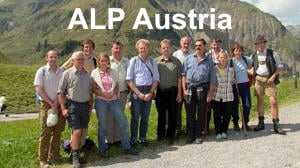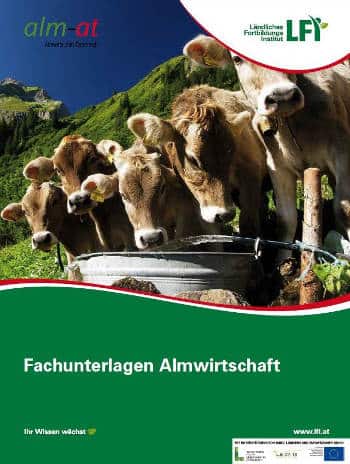Steirischer Almtag am 12.Juli 2025
Der Steirische Almtag findet heuer am 12. Juli auf der Stoakoglalm statt.

Einladung zur Kulturreise ins Riesengebirge vom 4. bis 9. Juni 2025
Diese Reise führt Leserinnen und Leser des „Alm- und Bergbauer“, aber auch andere Interessierte nach Nordböhmen.

Einladung zur Österreichischen Almwirtschaftstagung 2025
Die Österreichische Almwirtschaftstagung findet von 02. bis 04. Juli 2025 am Hochkar in Niederösterreich statt.

Almfeste in Niederösterreich ab 22. Juni 2025
Miteinander wandern, feiern und genießen – Almen waren schon immer sehr beliebt als Naherholungsraum

Alm- und Bergbauer Juni/Juli 2025
In der aktuellen Ausgabe April 2025 der Fachzeitschrift „Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt:

Almwirtschaftliche LFI-Kurse 2024 – 2025
Hier finden Sie die LFI-Almwirtschaftskurse der laufenden Bildungssaison

Alm- und Bergbauer Mai 2025
In der aktuellen Ausgabe April 2025 der Fachzeitschrift „Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt:

Alm- und Bergbauer April 2025
In der aktuellen Ausgabe April 2025 der Fachzeitschrift „Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt:

Wertvolle Tipps für die Almstellen- und Almpersonalsuche
Du suchst eine Stelle auf der Alm oder bist Bewirtschafter:in und hast einen Job auf deiner Alm anzubieten? Wir möchten dich auf nützliche Videos und Unterlagen hinweisen!

Alm- und Bergbauer März 2025
In der aktuellen Ausgabe März 2025 der Fachzeitschrift „Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt:

Alm- und Bergbauer Jänner/ Februar 2025
In der aktuellen Ausgabe Jänner/Februar 2025 der Fachzeitschrift „Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt:

Der Alm- und Bergbauer Dezember 2024
In der aktuellen Ausgabe Dezember 2024 der Fachzeitschrift „Der Alm- und Bergbauer“ werden folgende Themen behandelt: