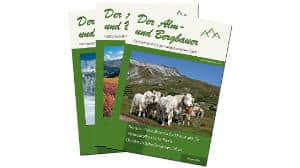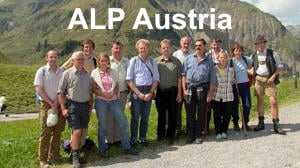Eindrücke von der Österreichischen Almwirtschaftstagung 2025

Im Juli 2025 war es wieder soweit: Nach 16 Jahren war das kleinste Almbundesland erneut Gastgeber der Österreichischen Almwirtschaftstagung
Trotz der im Bundesländervergleich eher beschaulichen Anzahl an Almen spürte man an den drei Veranstaltungstagen deutlich, dass die Almwirtschaft in Niederösterreich eine große Rolle spielt. Die Latschenalm am Hochkar diente als Tagungszentrum und mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung des Niederösterreichischen Alm- und Weidewirtschaftsvereins.
Obmann ÖR Josef Mayerhofer begrüßte voller Stolz die zahlreichen Teilnehmer und erschienen Ehrengäste darunter den Bürgermeister der Gemeinde Göstling/Ybbs Friedrich Fahrnberger, LR Ludwig Schleritzko, LK-Präsident NR Johannes Schmuckenschlager, Josef Obweger, Obmann Almwirtschaft Österreich und Josef Glatz, den Vorstand des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Schon die Eröffnungsworte machten klar: Diese Tagung würde nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Brücken schlagen – zwischen Regionen, zwischen Berufsgruppen und über Landesgrenzen hinweg. Das Tagungsprogramm war vielseitig und reich an Themen, die aktueller nicht sein könnten: Klimawandel und seine Auswirkungen, Naturgefahren und Risiken für landwirtschaftliche Betriebe, forstwirtschaftliche Herausforderungen und vieles mehr. Chefredakteurin Ulrike Raser führte durch den informativen Fachtag.
Den Auftakt der Fachbeiträge machte Bürgermeister Ing. Friedrich Fahrnberger. Mit spürbarem Stolz stellte er seine Heimatgemeinde Göstling an der Ybbs vor – eine Tourismusgemeinde mit rund 2.000 Einwohnern, eingebettet ins Dreiländereck von Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Er zeichnete ein lebendiges Bild der vielen Angebote und Freizeitmöglichkeiten, die gleichermaßen Urlauber wie Einheimische begeistern. LK-Präsident Schmuckenschlager dankte zu Beginn dem Organisationsteam rund um Josef Mayerhofer und August Bittermann für die Organisation dieser Veranstaltung. Es ist wichtig, die wesentlichen Bereiche des almwirtschaftlichen Lebens in ihren Fachreferaten anzusprechen. Die Almwirtschaft braucht Personal, Vieh und gute Ausbildung. Besonders das Thema Wasser bezeichnete er als Schlüsselressource. „Zu viel oder zu wenig, beides ist problematisch!“, so Präsident Schmuckenschlager. Auch beim Thema Wolf äußerte er sich klar: In Almregionen habe er keinen Platz! Tirol und Niederösterreich seien die ersten Bundesländer gewesen, die dazu eine Petition initiierten. Almen sind Kulturlandschaft, die von Menschenhand erschaffen wurden. Um dort wirtschaften zu können, braucht es Regulative.
Niederösterreichs Almwirtschaft im Blickfeld
Gerald Bohrn, technischer Leiter der NÖ Agrarbezirksbehörde, gab einen eindrucksvollen Überblick über die Almwirtschaft in Niederösterreich. Die 108 Almen und Weiden liegen im Süden des Bundeslandes, an den Ausläufern des Alpenbogens mit einer Gesamtfläche von 7.900 ha (4.700 ha Weidefläche). Auf diese Almen/Weiden werden rund 6.600 Tiere von 842 Betrieben aufgetrieben. Aufgrund der Tatsache, dass Niederösterreich besonders viele Niederalmen aufweist, liegen viele Almen in waldreichen Gegenden. Damit verbunden ist, dass diese Almen einem starken Anflug ausgesetzt sind und bei zu geringer Bestoßung laufend eine Verwaldung der Weideflächen droht. Daher ist auf diesen Almen der Auftrieb einer ausreichenden Anzahl an Weidevieh eine grundlegende Voraussetzung.
Vorsorge bringt Sicherheit
Die Anpassung an den Klimawandel ist eine komplexe und vielschichtige Aufgabe, die vor allem die Landwirtschaftsbetriebe massiv betrifft. Es gilt, Strategien gegen den Klimawandel zu entwickeln, um auch künftig bestehen zu können. Über dieses Thema referierte Mario Winkler von der Österreichischen Hagelversicherung. Es gibt ausreichend meteorologische Entwicklungen und naturwissenschaftliche Daten, die den Klimawandel untermauern. So haben sich die Hitzetage (Tage mit mehr als 30 Grad Celsius) in St. Pölten seit dem Jahr 1985 verdoppelt. Die Land- und Almwirtschaft muss sich diesen neuen Bedingungen anpassen. Eine Kernmaßnahme, die in Reaktion auf den Klimawandel getroffen werden muss, ist das Vorsorgen durch versichern. Dadurch wird der Klimawandel zwar nicht eingebremst, aber die Auswirkungen für die Bäuerinnen und Bauern werden abgefedert. Wichtig sei aber auch die Erhaltung der landwirtschaftlich genutzten Flächen. Verbaute und zubetonierte Flächen reduzieren die natürliche Aufnahmefähigkeit bei Starkregenereignissen. Es gilt daher die Bodenqualität zu erhalten bzw. zu steigern, denn hoher Humusgehalt bedeutet: gutes Wasserspeichervermögen, besseres Überdauern von Trockenphasen, Boden als CO2-Speicher erhalten und Steigerung der biologischen Aktivität der Böden.
Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Pflanzenbestand
Den bereits angesprochenen Einfluss des Klimawandels auf den Boden, das Bodenleben und den Pflanzenbestand behandelte Andreas Bohner, Wissenschaftler am Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein in seinem Fachreferat. Almböden weisen ganz spezifische Merkmale und Eigenschaften auf. So haben Almböden einen höheren Humusgehalt im Oberboden. Dieser gehört neben der geringen Wurzeldichte im Oberboden und einer geringeren Durchwurzelungstiefe des Unterbodens zu den besonderen Merkmalen von Almböden. Aber auch die Seehöhe spielt hier eine ganz besondere Rolle für den Pflanzenbestand. Die jährliche Niederschlagsmenge, die Schneedecke und die Dauer der Schneehöhe nehmen mit der Seehöhe zu. Die Vegetationsperiode verkürzt sich daher im Durchschnitt um 6-7 Tage pro 100 m Höhenzunahme. Dazu kommt die niedrige Lufttemperatur als weiterer Faktor für das Pflanzenwachstum in der Almregion. Der Klimawandel bringt Gewinner und Verlierer in der Almvegetation mit sich. Die Erhöhung der Bodentemperatur führt zu einer Steigerung der Aktivität von Bodenorganismen, wenn ihnen gleichzeitig ausreichend Wasser und Nahrung zur Verfügung steht. Vor allem in niederschlagsreichen Almregionen werden sich die Wachstumsbedingungen für die Almvegetation aufgrund des Klimawandels deutlich verbessern. Auf trockenheitsgefährdeten Almstandorten hingegen nimmt die Gefahr von Trockenschäden weiter zu, dh. starke jährliche Ertragsschwankungen sind zu erwarten. Pflanzen reagieren auf die klimawandelbedingten geänderten Standort- und Konkurrenzverhältnisse vor allem durch Ausweichen auf geeignete Lebensräume. Aufgrund des Klimawandels ist ein früherer Auftrieb erforderlich geworden.
Für genügend Wasser auf der Alm sorgen
Einen praxisnahen Beitrag über die Wasserversorgung den Almen am Hochkar bekamen die Tagungsteilnehmer von Benedikt Ennsfellner von der NÖ Agrarbezirksbehörde. Dass der Klimawandel die Wasserversorgung als zentrales Thema hat, wurde auch von den Vorrednern schon bestätigt. Zusätzlich betont Ennsfellner noch, dass eine Erwärmung der Luft um 1 Grad Celsius dazu führt, dass die Luft etwa 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Dies führt unter anderem zu einer stärkeren Verdunstung von Gewässern. Seitens der Agrarbezirksbehörde werden im Rahmen der Beratung und Planung alle Möglichkeiten der Wassergewinnung einbezogen. Hier steht in erster Linie eine Nutzung von Quellen im Mittelpunkt. In Kalkgebieten ist aber auch die Regenwassernutzung eine Alternative. Foliensammler am Königsberg sowie am Hochkar kommen hier zum Einsatz. Problembereiche sind jedoch die Verschmutzung sowie die Erwärmung des gewonnenen Regenwassers. In manchen Bereichen (Hinteralm/Zeislalm) wurden auch Dachsammler errichtet, um ausreichend Tränkewasser für die Tiere zur Verfügung zu haben. Auch kleinere Teiche wurden so bereits angelegt. Regenwassernutzung mit einer technisch aufwendigeren Lösung stellen Betonzisternen oder Kunststoffzisternen dar. Sie sind jedoch kostenintensiver. Wichtig ist eine Lösung, die ausreichend Wasserreserven für die Weidetiere bietet. Das Alter, die Anzahl der Tiere und Auf- und Abtriebszeitpunkt sind bei der Planung zu berücksichtigen, um die für eine erfolgreiche Alpung erforderliche Wassermenge möglichst genau zu bemessen. Anhand von Beispielen am Hochkar wurden diese Planungsphasen anschaulich erläutert.

Festabend mit kulinarischen Schmankerln und viel Tradition
Am Abend wurde in dem festlich dekorierten Tagungszelt ein feierlicher Abendempfang abgehalten. LH-Stellvertreter Stefan Pernkopf überbrachte die Grüße des Landes Niederösterreichs und stricht den hohen Wert der Almwirtschaft für Österreich hervor. Josef Obweger, der Bundesobmann der Almwirtschaft Österreich, dankte für die Organisation und den spannenden Fachtag. Wichtig sei es auch miteinander zu reden und über die herausfordernden Themen zu diskutieren. Ein weiterer Höhepunkt war die Unterzeichnung einer Charta für eine partnerschaftliche Interessenvertretung. Diese wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen ins Leben gerufen. Im Zuge dieses Festabends wurde diese Charta von Obmann Josef Obweger und Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger unterzeichnet. Der Charta liegt das gemeinsame Bewusstsein zugrunde, dass Frauen und Männer unterschiedliche, aber gleichermaßen wertvolle Perspektiven einbringen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Interessenvertretung ist Voraussetzung für eine gelingende Zukunftsgestaltung der österreichischen Land- und Forstwirtschaft.
Nach einem gemütlichen Festessen, musikalisch umrahmt von der „Höhenrausch Musi“ aus Göstling an der Ybbs und Tanzeinlangen vom Volkstanzkreis Traisen-Gölsental, folgte eine kulinarische Entdeckungsreise: Die Gäste verkosteten ausgewählte regionale Käsesorten mit passendem Most, lernten die Produzentinnen und Produzenten kennen und ließen den Tag bei angeregten Gesprächen ausklingen.
Text: Petra Fürstauer-Reiter

2. Tag – Exkursion zur Schwarzalm
„Bitte einsteigen, die Busse fahren ab“, so gaben die Organisatoren den Startschuss für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Almwirtschaftstagung zur Exkursion auf die Schwarzalm. Vom Parkplatz der Talstation der Hochkar-Bergbahnen fuhren die Busse über die Mautstraße zur B25 und von der B25 über einen Forstweg zur Schwarzalm. Auf dem letzten Stück der engen Forststraße konnten die Busfahrer ihr wahres Können beweisen und bei so manchem Teilnehmer zeigte sich eine gewisse Blässe im Gesicht.
Schon nach einer kurzen Wanderung war die erste Station des Tages erreicht. Bei der Jägerhütte stellte Obmann Clemens Blamauer die Schwarzalm vor. Die Schwarzalm, ein Teil der Servitutsweide Lassingalpe-Hochreith, umfasst eine Bruttofläche von 673 ha, davon 231 ha Futterfläche. 2024 wurden 230 Rinder (166 RGVE), hauptsächlich Jungvieh, aber auch Mutterkühe mit Kälbern von 15 Betrieben aufgetrieben. Das Hochkar, der zweite Teil der Servitutsweide Lassingalpe-Hochreith, umfasst eine Bruttofläche von 603 ha, davon 257 ha Futterfläche. Hier wurden 2024 230 Rinder (162 RGVE) von 15 Betrieben aufgetrieben. In Summe nutzen 30 von 43 berechtigten Betrieben ihre Weiderechte aus. Die Servitutsweide Lassingalpe-Hochreith, im Besitz der Österreichischen Bundesforste, gehört zu den 5 Einforstungsalmen in Niederösterreich nach dem Kaiserlichen Patent vom 5. Juli 1853. „Die detaillierten Vorgaben für die Bewirtschaftung gibt die Regulierungsurkunde vor, die internen Regeln sind im Vertretungsstatut formuliert“, erläuterte Obmann Blamauer. Sowohl am Hochkar als auch auf der Schwarzalm hat es in diesem Jahr einen Halterwechsel gegeben. „Wir hatten das Glück, wieder sehr engagierte Halterleute zu finden“, freute sich Clemens Blamauer.
Aus Sicht des Tourismus zeigen die beiden Teile ein sehr konträres Bild. Das Hochkar, der touristische Hotspot in der Region, gilt als schneesicherstes Schigebiet in Niederösterreich und als Mountainbike- und Wanderparadies im Sommer mit einem umfangreichen Gastronomieangebot. Die Schwarzalm gilt eher als Geheimtipp für Naturgenießer und Wanderer. Nach der Almvorstellung wanderten die Teilnehmer:innen zur Schwarzalmhütte, wo die Almbauern schon mit regionalen Köstlichkeiten aufwarteten. Besonderen Anklang fanden die Kuchenköstlichkeiten der Almbäuerinnen.

Das Thema „Einforstungsrechte und Almwirtschaft – Wie schafft man ein gutes Miteinander“ beleuchteten die Referenten aus verschiedenen Blickwinkeln. DI Roman Burgstaller, Büro für Einforstungsrechte der ÖBf AG, informierte die Teilnehmerinnen über die Rahmenbedingungen für Einforstungsalmen. Er erläuterte den Inhalt der betroffenen Gesetze, der Regulierungsurkunden und deren Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Berechtigten und Verpflichteten. Besonders spannend war der Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Einforstungsrechte. „Die Bewirtschaftung der Almen muss sich den zukünftigen Herausforderungen, vor allem verursacht durch den Klimawandel, anpassen“, betonte Burgstaller. „Das Wachstum der Vegetation verschiebt sich, verschiedene Pflanzen breiten sich vermehrt aus, der Futterertrag ändert sich und als besondere Herausforderung gilt es zukünftig, die Wasserversorgung der Weidetiere sicherzustellen.“ DI Bernhard Funcke, Ing. Fritz Danner von den Bundesforsten und Obmann Clemens Blamauer berichteten den Teilnehmer:innen über die Gestaltung eines guten Miteinanders. „Das Wichtigste für ein gedeihliches Miteinander ist ein wertschätzender Umgang, offene und ehrliche Kommunikation miteinander sowie ein offenes Ohr für die Aufgaben und Probleme des Gegenübers“, sind die drei Protagonisten überzeugt.
Nach den interessanten Vorträgen und den Köstlichkeiten aus der Region führte die Wanderung über frisch rekultivierte Weideflächen wieder zu den Bussen, um die nächste Stationen, die Bergbauernschule Hohenlehen und die Schlachtgemeinschaft Hohenlehen-Fleisch, zu erreichen. Während der Fahrt brachten die Reisebegleiter den Teilnehmer:innen wichtige Daten über die Region, den Tourismus, die Landwirtschaft und die Almwirtschaft näher. In den drei Gemeinden der Region, Göstling an der Ybbs, St. Georgen am Reith und Hollenstein an der Ybbs werden 8 Almen mit ca. 2.500 ha Fläche, davon 950 ha Futterfläche bewirtschaftet. Ca. 100 Betriebe treiben 1.100 Stück Almvieh, hauptsächlich Rinder, auf.
Übersicht: Auftrieb in der Region Göstling an der Ybbs, St. Georgen am Reith und Hollenstein an der Ybbs
Alm | Gesamtfläche | Futterfläche | Stück Rinder | Anzahl Auftreiber |
Hochkar | 602 | 255 | 230 | 15 |
Schwarzalm | 673 | 226 | 230 | 15 |
Dürrenstein | 589 | 239 | 179 | 15 |
Königsberg-West–Kitzhütte | 146 | 59 | 138 | 14 |
Königsberg-Ost–Siebenhütte | 369 | 81 | 147 | 15 |
Schwelleckau | 17,6 | 32 | 30 | 5 |
Nieder-Scheibenberg | 41 | 32 | 66 | 11 |
Bauernboden | 76 | 42 | 74 | 10 |
Die Zahlen beweisen, dass die Almwirtschaft kein Auslaufmodell, sondern gelebte Realität in der Region ist.
Grünland, Viehhaltung, Milchwirtschaft und biologische Wirtschaftsweise (60 % der Betriebe sind Biobetriebe) sind die wichtigsten Standbeine der Landwirtschaft in dieser Region. Besondere Bedeutung hat natürlich auch die Forstwirtschaft. Dass der Tourismus einen hohen Stellenwert in der Region hat, zeigen die Nächtigungszahlen mit über 100.000 Nächtigungen/Jahr. Ein ganz wichtiger Aspekt für die Land- und Forstwirtschaft ist die Ausbildung der nächsten Generation. Mit der landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen (Bergbauernschule Hohenlehen) und der Fachschule Unterleiten, einer Expositur von Hohenlehen in Kooperation mit der Schlachtgemeinschaft Hohenlehen-Fleisch, wird hier ein umfassendes Bildungszentrum geboten.
Text: August Bittermann


LFS Hohenlehen als Gastgeberin bei der Österr. Almwirtschaftstagung
Die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Hohenlehen ist seit vielen Jahrzehnten ein wesentlicher Ausbildungsort für junge Menschen im Bereich der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und insbesondere der Alm- und Weidewirtschaft. Mitten in der eindrucksvollen Landschaft des Oberen Ybbstals gelegen, verbindet die Schule Tradition mit modernen Ausbildungsinhalten. Neben praxisnaher Tierhaltung und Forstbewirtschaftung ist Hohenlehen bekannt für seine praxisorientierten Lernformen, den engen Bezug zur Region, sowie die Vermittlung nachhaltiger Wirtschaftsweisen.
Unter dem Motto „Bildung hat einen Wert“ öffnete die Schule ihre Tore für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung und stellte ihre vielfältigen Schwerpunkte in Form eines Stationenbetriebs vor.
8 Stationen am Almwirtschaftstag
Die Besucherinnen und Besucher erwartete ein abwechslungsreicher Rundgang mit acht Stationen, die unterschiedliche Facetten der Bildungs- und Praxisarbeit an der LFS Hohenlehen beleuchteten:
Der Besuch zeigte eindrucksvoll, wie praxisnahe Ausbildung, nachhaltige Wirtschaftsweisen und regionale Vernetzung ineinandergreifen. Acht Stationen (Jungzüchter, Bäuerliche Schlachtgemeinschaft, traditionelle Zaunform „Andrahhog“, Fischteiche, Most und Käse, Einblick in Forstbewerbe, usw.) gaben einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Schule und die Herausforderungen und Chancen der Alm- und Berglandwirtschaft.
Damit leistete die LFS Hohenlehen einen wertvollen Beitrag zur Tagung und unterstrich ihre Rolle als Kompetenzzentrum für Berg- und Almwirtschaft im Mostviertel.

Eindrücke von zwei gelungenen Tagen:
Dieses Video wird von dem Anbieter YouTube unter der Website der Almwirtschaft Österreich eingebettet. Das Video wird erst beim Klick auf den Play-Button geladen. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.